
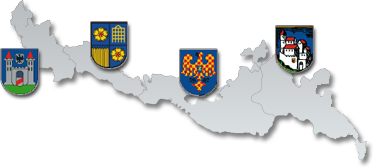

Foto: Karel-Paourek/Meeting Brno – Brünner Versöhnungsmarsch 2015
Viele Vertriebene nutzten die nach 1989 offenen Grenzen zur Tschechoslowakei und besuchten die Orte und Landschaften ihrer Jugend. Nach jahrzehntelanger Trennung knüpften sie wieder an alte Kontakte an und machten sich an die Renovierung und Pflege von Denkmälern und Friedhöfen. In der Euphorie nach dem Ende des KP-Regimes gelang die Veranstaltung von Treffen in den Heimatorten: „1991, da war ja in Altstadt was los, (…) da ist ja der Platz zu klein geworden. (…) Der Bürgermeister war (…) sehr nett. Da hat er selber Angst gehabt um seine Leute und ich habe Angst gehabt um meine Leute.”
Unterschiedlich gestalteten sich die Kontakte zu den heutigen Besitzern von Häusern und Höfen: „Ich weiß unser Haus steht noch, da ist ein Rumäne drinnen. Ganz ein netter Kerl (…), der ist genauso alt wie ich. Genau den gleichen Tag geboren.” Manchmal verhinderten aber auch Angst und Scheu vor der (Wieder-)Begegnung die Kontaktaufnahme: „Das einzige was ich mich noch nicht getraut habe, obwohl wir schon so oft drüben waren, (ist), dass ich einmal angeklopft hätte, gesagt, ich möchte gern mit meinen Kindern in das Haus reingehen.”
Ein wichtiger gemeinsamer Begegnungsraum für Vertriebene, Verbliebene und Neusiedler wurden die Kirchen: „Wir haben jedes Mal wenn ich drüben bin mit dem Pfarrer einen guten Kontakt, er sperrt uns die Kirche auf, (…) wir beten dort einen Vater unser.” Man schloss an die früheren Traditionen an und bezog die neuen Bewohner ein: „Da war früher ja immer ein Kirtag (…) und der war ganz beliebt, und da sind sie wieder dazu übergangen das wieder einzuführen, (…) sind auch ein paar Tschechen da. (…) Es wird sich schon was entwickeln.”
Doch nicht alle teilten das neu erwachte Interesse: „Ich möchte gar nicht mehr hinüber. Wenn sie mir das Haus geben täten, ich möchte es gar nicht.”
Eine besondere Situation ergab sich dort, wo die Herkunftsdörfer nicht mehr stehen, und nunmehr zum ersten Mal nach 1945 überhaupt ein Besuch in der ehemaligen Sperrzone an der Grenze möglich wurde. Der Zerstörung der Orte folgte die Zerstörung der tradierten Erinnerung an diese: „Dann noch einmal hinein, Ribisel, völlig verwilderte Ribiselstauden und also ein paar so Steinreste halt, und (…) die Schwester hat gesagt, also da haben wir gespielt, auf dem Teich da hat es eine Brücke gegeben.” Manchmal füllen sich diese Plätze der Erinnerung mit neuem Leben: In Romau [Romava] errichteten tschechische Schüler aus Stein- und Mauerresten dort, wo das alte Sakralgebäude stand, eine Waldkapelle. Jährlich laden sie zu Gedenkmessen unter freiem Himmel.
An gerissene Fäden wird so wieder angeknüpft, zwei Hälften einer Geschichte zusammengefügt. Das Interesse und die Empathie der jungen tschechischen Bewohner, die sich bei der „Spurensuche” nach der Vergangenheit ihrer Ortschaften und Regionen des Wissens der ehemaligen deutschen Bewohner bedienen, wirkt heilsam: „Am nächsten Tag kommt die ganze Gruppe nach Niedersulz und ich merke auch atmosphärisch, dass die jungen Studenten von einer derartigen Freundlichkeit mir gegenüber waren.”
(Text von Niklas Perzi aus der Ausstellung „Langsam ist es besser geworden. Vertriebene erzählen vom Wegmüssen, Ankommen und Dableiben”)

Tschechische Schüler während der Wahlfahrt in das „verschwundene“ Dorf Romau/Romava, 2010. Foto: Niklas Perzi
Virtueller Rundgang durch das „verschwundene“ Romau
YouTube – 6 Minuten