
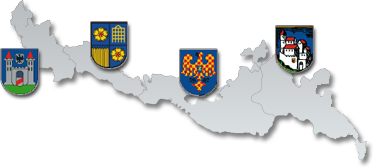

Gedenkstätte am Friedhof von Waldkirchen. Neben dem bekannten „Brünner Todesmarsch“ gab es noch andere „Todesmärsche“ während der Vertreibung, so u.a. den „Iglauer Todesmarsch“ bei dem 23 Kleinkinder (laut Totenbuch der Pfarre Waldkirchen) im Juni 1945 hier verstorben sind. Foto: Niklas Perzi
Unsicherheit, Ungewissheit, existentielle Bedrohung – die ersten Wochen und Monate nach Kriegsende waren von Chaos geprägt. Viele Menschen waren schon in Österreich, die anderen lebten noch „drüben”, in Furcht vor dem Kommenden, den neuen Machthabern in den Ortschaften, auf ihren Höfen und in ihren Häusern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Die Männer waren oft abwesend, in Kriegsgefangenschaft oder in einem der Straf- und Arbeitslager, etwa in Znaim [Znojmo]. Die Frauen mussten mit den neu eingesetzten Besitzern die Grundgrenzen abgehen oder wurden zu Arbeitseinsätzen eingeteilt: „In den Spitälern haben sie arbeiten müssen, Fußboden schrubben, nur die schlechteste Arbeit, ohne Lohn.” Schutz vor Übergriffen boten die Anwesen von österreichischen Staatsbürgern, die nicht geplündert werden durften, aber auch tschechische Verwandte, Bekannte oder mitunter auch die neuen Eigentümer. Viele Deutsche flohen über die Grenze nach Österreich, nachdem Gerüchte von einem Abtransport nach Russland gestreut worden waren: „Sie (die Mutter) hat gesagt, ja nicht nach Russland.” Vor allem in Südmähren gingen aber auch die Vertreibungen weiter. Der „Brünner Todesmarsch” forderte Ende Mai 1945 hunderte Tote. Die in Lagern internierten Iglauer mussten im Juni Richtung Österreich aufbrechen: „Es sind viele dabei gewesen, die nicht mehr weiterkonnten, sie sind in den Straßengraben geworfen worden.” 23 Kinder starben, viele an Erschöpfung, und wurden im niederösterreichischen Waldkirchen beerdigt.
In Österreich trafen die Menschen auf völlig unvorbereitete Einwohner in den Grenzorten: „Wo fahrt ihr denn hin? Ja, sie haben uns ausgjagt, wir wissen nicht, wo wir hinsollen. Na, hat sie gesagt, fahrst hinein, ihr könnts bei uns bleiben”. Nach der ersten Nacht ging es weiter: Betteln um Essen, um ein Dach über dem Kopf, um Kleidungsstücke zum Anziehen. Viele Kinder erlebten das Geschehen zunächst als Abenteuer, spürten erst später die Angst und existentielle Verzweiflung der Eltern. Erste Auffangnetze boten Verwandte und Bekannte oder Besitzungen und Beziehungen auf der österreichischen Seite der Grenze. Viele wollten in Grenznähe bleiben, weil sie auf Rückkehr hofften: „Es hat immer geheißen, der Weltfrieden verhandelt noch.” Beim Zusammenleben mit der einheimischen Bevölkerung in Österreich stießen sie auf viel Hilfsbereitschaft, aber auch Ablehnung: „Auf solche Leute, die nix haben, sind wir nicht neugierig”. Die Menschen waren auf ihre informellen Netzwerke angewiesen. Wer niemanden hatte oder fand, musste weiterziehen. Wohnraum und Ressourcen waren beschränkt, oft lebte eine Großfamilie im Ausnehmerstübchen: „Da haben wir ein Zimmer gehabt mit acht Leuten.” In den Dörfern, wo viele Männer noch in Kriegsgefangenschaft und die Zwangsarbeiter bereits weg waren, wurden vor allem arbeitsfähige Männer auf den Bauernhöfen gerne aufgenommen. Schwerer hatten es Frauen, Alte und Kinder. Im Frühjahr 1946 tauchten erste Gerüchte über die Transporte nach Deutschland auf, das Bangen begann von Neuem.
(Text von Niklas Perzi aus der Ausstellung „Langsam ist es besser geworden. Vertriebene erzählen vom Wegmüssen, Ankommen und Dableiben”)